Cover und Anfang

Am 15. August erscheint mein neues Buch. Es ist eine Geschichte, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, und ich denke, dass sie für uns alle unperfekten Frauen wichtig ist. Zumindest hoffe ich das. Den Klappentext stelle ich noch vor, aber erst mal gibt es einen Einblick in den Anfang der Geschichte.
Ugly fat thing? – Kapitel 1
Ashleys. Das sind so große, blonde Sportskanonen, die in der Highschool die Cheerleader angeführt haben, deren Körper heute Sports Illustrated und Cosmopolitan zieren, die im Bikini am Strand eine ebenso gute Figur machen wie auf den roten Teppichen der Welt.
Ashleys. Sie waren immer die Beliebtesten, haben jeden Jungen rumbekommen, sogar den Quarterback, und waren natürlich auch Prom Queen.
Ashleys.
Warum meine Eltern mir diesen Namen gegeben haben, weiß ich nicht. Vielleicht, um mich auf den richtigen Weg zu bringen. Wie enttäuschend war es für sie, festzustellen, dass ihre blonde Sportskanone das genaue Gegenteil wurde. Klein, dunkle Haare und zu allem Übel auch noch dick. Aus den paar Kilos zu viel, die ich als Kind hatte, wurden im Laufe der Zeit viel zu viele. Das Leben ist nicht immer sanft zu Mädchen, die nicht wie die typischen Ashleys aussehen.
»Willst du das wirklich essen?«, fragt Mom mich, als sie in die Küche kommt.
Ja, ich bin achtundzwanzig und wohne noch bei meinen Eltern. Erschießt mich jetzt.
»Ich hab Hunger.«
»Aber ein Salat wäre doch viel besser für dich.«
»Das macht aber nicht satt.«
»Kind, wenn du alles so in dich hineinstopfst, wirst du nie einen Mann finden. Deine neue Hose kneift auch schon wieder. Das ist kein sehr vorteilhafter Look.«
Innerlich zähle ich bis zehn, um meinen Zorn zu unterdrücken. Wütend werden bringt rein gar nichts. Dann fängt sie an zu weinen, fragt, was sie denn falsch gemacht habe, sie wolle doch nur helfen, und Dad sagt dann: »Ashley, es ist nicht richtig, mit den Gefühlen anderer zu spielen.«
Tausendmal durchgespielt.
Stattdessen nicke ich nur und nehme meine Pizza mit in mein Zimmer. Ich lege mich auf mein Bett, schalte den Fernseher an, gucke Wiederholungen von Gossip Girl und frage mich einmal mehr, wie mein Leben aussähe, wenn ich den anderen Ashleys ähnlicher wäre. Größer, blonder und vor allem schlanker.
Den Pizzakarton schiebe ich unter das Bett, als ich mit dem Essen fertig bin. Die entsorge ich immer dann, wenn niemand zu Hause ist, und niemals in unserer Mülltonne. Mein Blick fällt auf den Schreibtisch, und ich sehe die halbfertige Wickelbluse dort liegen. Mit einem leisen Stöhnen stehe ich auf und setze mich auf meinen knarrenden Schreibtischstuhl. Ich habe die Armlehnen abgeschraubt, weil sie mir in die Seiten gestochen haben. Die Nähmaschine, die ich bereits habe, seit ich dreizehn bin, stelle ich an, bevor ich den Stoff durch die Hand gleiten lasse. Es ist grauer, fester Baumwollstoff, der ein wenig meliert ist. Er hat einen geringen Anteil an Elasthan, so ist er schön anschmiegsam. Er fühlt sich schön an, fest, ein wenig rau, aber trotzdem nicht kratzig.
Ich liebe es, Stoffe anzufassen. Manche sind so weich, dass man sie direkt an die Wange drücken will. Manche sind schwer und geben einem dieses besondere Tragegefühl, als wäre man in eine Umarmung gehüllt. Andere sind so glatt, dass sie ohne Widerstand durch die Finger gleiten, als wären sie schon wieder verschwunden, wenn man sie doch gerade erst gefunden hat. Mein Lieblingsstoff ist Samt, aber gleichzeitig hasse ich ihn auch, weil er so dick ist, dass dicke Menschen darin nur noch dicker aussehen.
Ich suche nach den bereits abgesteckten Stellen, schiebe den Stoff unter das Füßchen der Nähmaschine und betätige das Fußpedal. Vorsichtig erst, dann etwas stärker. Es ist jedes Mal wie ein Wunder, wenn plötzlich eine gerade Naht erscheint, da wo vorher nur lose Stoffstücke waren.
Ruhig werde ich. Entspannt. Alles fällt von mir ab. Ich höre kaum noch das Gedudel des Fernsehers, sondern bin in meiner eigenen Welt, in der ich schöne Dinge erschaffe. Als ich schließlich den letzten Faden abschneide, durchflutet mich Stolz, weil ich es wieder geschafft habe, etwas fertig zu stellen. Ich habe etwas kreiert. Das ist so ein erhabenes Gefühl, auch nach fast fünfzehn Jahren, in denen ich jetzt meine eigene Kleidung nähe. Das meiste zumindest. Manchmal träume ich davon, mir auch eigene Unterwäsche zu nähen, aber Lingerie trägt man doch eigentlich nur, damit jemand anderes sie sieht. Und wer würde schon ein Walross in Dessous sehen wollen?
Ich ziehe mein Oberteil aus und wickele mich dann in meine Bluse. Leise schleiche ich mich ins Schlafzimmer meiner Eltern, um in den Spiegel zu sehen. Ich habe keinen. Das Elend will ich nicht in Endlosschleife sehen.
Das Licht mache ich an, bevor ich mich begucke. Ich versuche es, so weit wie möglich zu vermeiden, aber ich muss ja sehen, ob die Bluse an mir auch gut aussieht oder ob es eine Verschwendung von Zeit, Stoff und Liebe war. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass ich jemals so wunderschöne Kleidung tragen werde wie Blair und Serena, aber ich will auch keine Säcke anziehen, auch wenn die Öffentlichkeit das wohl als angemessene Kleidung für Dicke betrachtet.
Alles, was ich mir nähe, bedeckt mich vollständig. Ich zeige keine nackte Haut, nur die Hände und das Gesicht. Aber trotzdem haben meine Stücke eine Form, meine Form eben. Es sind keine Klamotten für den Runway, aber sie sind aus hochwertigen Stoffen und die Schnitte sind vorteilhaft.
Als ich mich im Spiegel betrachte, konzentriere ich mich nur auf den Sitz der Bluse. Sie sieht toll aus. Ich vermeide jeden Blick in mein Gesicht, will das Doppelkinn nicht sehen, das sich da gebildet hat, will die prallen Wangen nicht sehen, in die mich meine Großtante als Kind immer gekniffen hat.
Bevor ich versehentlich doch hinschaue, schleiche ich zurück in mein Zimmer. Vorsichtig ziehe ich die Bluse aus, nur um schnell mein Oberteil überzuziehen, bevor mein Blick auf die ganzen Schwabbelstellen fallen kann, die meinen Oberkörper bedecken. Dann bügele ich meine neue Bluse. Eigentlich ist es ja eine Schande, dass kaum jemand das gute Stück sehen wird.
Es klopft an der Tür, und ich sehe mich um, ob auch alles verborgen ist, was irgendwie Unmut bei meiner Familie hervorrufen könnte. Obwohl es je nach Besucher eigentlich vollkommen unnütz ist, denn für Mom ist meine bloße Existenz ein rotes Tuch.
»Herein.«
»Hey«, sagt mein Bruder Chad lächelnd, als er hereinkommt.
Manchmal frage ich mich, ob es nicht unfair ist, dass er all die guten Gene abbekommen hat und ich nur den Abfall. Er ist groß, blond, hat ein Sixpack und ist Instagram-Influencer. Vier Millionen Follower.
Ich hatte auch mal einen Instagram-Account, aber das perfekte Leben der anderen, unter ihnen mein Bruder, hat mich deprimiert. Daher habe ich ihn gelöscht. Was für Fotos sollte ich auch posten? Wer will meinen unförmigen Körper schon sehen?
»Hi, wie war Cancun?«
»Wahnsinnig schön. Du solltest auch mal hinfahren. Türkises Wasser, weißer Strand, Palmen.«
Wir beide wissen, dass ich niemals nach Cancun fahren würde. Wozu auch? Ich lege mich ja nicht einmal hier in Santa Monica an den Strand und um dort hinzukommen muss ich nicht stundenlang in einem winzigen Flugzeug eingesperrt sein, in dem ich wirke wie eine Sardine in der Büchse. Es ist mein persönlicher Albtraum, dass irgendjemand mich mit einem Wal verwechseln könnte.
»Irgendwann vielleicht.«
»Wie geht es dir?«
»Wie immer.«
»Nichts Neues?«
»Nein.«
»Das ist traurig.« Er sieht ein wenig verlegen aus. »Hey, Mom hat mich gefragt, ob ich dir nicht mal ein Sportprogramm zusammenstellen kann.«
Ich muss mich wappnen. Schnell schließe ich die Schotten, ziehe die Mauern hoch, die eigentlich immer oben sind, nur nicht, wenn man mich in meinen eigenen vier Wänden erwischt. Hier hatte ich keinen Angriff erwartet. Was vielleicht naiv ist. Schließlich wohnen auch Mom und Dad in diesem Haus und beide können das Wort Privatsphäre nicht einmal buchstabieren.
»Ich hab ihr gesagt, dass Sport allein nicht reicht, dass du auch deine Ernährung umstellen musst.«
Es ist nicht so einfach, mir zu sagen, dass er es nicht böse meint. In dieser Familie weiß nur niemand, wie man nicht übergriffig ist. Oder sagen wir lieber, wie man mir gegenüber nicht übergriffig ist. Denn sie würden es sich immer verbitten, wenn ich mich so in ihr Leben einmischen würde. Aber wenn man dick ist, hat man offenbar nicht die gleichen Rechte. Wie sonst ließe es sich erklären, dass sich so viele fremde Menschen bemüßigt fühlen, den Körper anderer zu kommentieren?
»Hey, ich mach das gern für dich. Aber wir können nur hier trainieren.«
Eigentlich will ich es nicht wissen, aber meine masochistische Ader ist stark ausgeprägt. »Wieso?«
»Nun ja …« Wenigstens ist er verlegen. »Ich muss an meinen Ruf denken. Du verstehst schon. Nichts gegen dich.«
»Natürlich nicht.«
Was ich verstehe ist, dass es meinem Bruder, dem Fitnessguru, peinlich ist, eine dicke Schwester zu haben. Wundern tut es mich nicht, aber gehofft hatte ich doch was anderes.
»Ich wusste, dass du es verstehst. Ich komme dann morgen früh vorbei.«
»Wozu?«
»Zum Training natürlich, du Dummchen.« Er lacht.
»Ich muss arbeiten.«
»Aber erst um neun. Ich komm um halb sieben, dann haben wir eine Stunde und du hast noch Zeit zum Duschen.«
Wahrscheinlich meint er es vollkommen harmlos, ohne irgendwelche Hintergedanken. Aber ich verstehe, dass er denkt, dass ich schwitzen werde, als hätte ich einen Marathon hinter mich gebracht.
Nicht dass das weit von der Wahrheit entfernt wäre. Ich schwitze schon, wenn ich die Stufen in die erste Etage hinaufgehe, aber es ist was anderes, wenn man darauf hingewiesen wird.
»Oh, okay.«
»Gut, dann bis morgen. Wäre doch gelacht, wenn wir es nicht schaffen würden, dich in eine Schönheit zu verwandeln.« Er küsst mich auf die Wange, bevor er geht.
Und ich? Ich weine.
Selbst halte ich mich nicht für eine Schönheit, eher das genaue Gegenteil, aber die eigenen Befürchtungen von anderen, noch dazu meiner Familie, gespiegelt zu bekommen, löst totale Verzweiflung aus. Ein wenig unbeholfen lasse ich mich auf die Kante meines Bettes sinken und wische mir die Tränen ab. Auch wenn ich solche Kommentare inzwischen von meiner Familie gewohnt bin, stechen sie mir immer noch ins Herz. Ist es denn so unverständlich, dass ich mir erhoffe, dass mich irgendjemand schön findet, auch dann, wenn ich es nicht tue? Glauben würde ich es dennoch nicht, muss ich zugeben, sondern wahrscheinlich denken, dass sie das ja sagen müssen, weil sie mit mir verwandt sind. Manchmal wünschte ich, ich müsste einfach niemanden sehen. Aber meistens sind tatsächlich meine eigenen Gedanken der größte Feind.
Den Rest des Abends verkrieche ich mich in meinem Zimmer, plündere meine Ration für schlechte Zeiten und hoffe auf eine gute Fee, die vorbeikommt und mir drei Wünsche erfüllt.

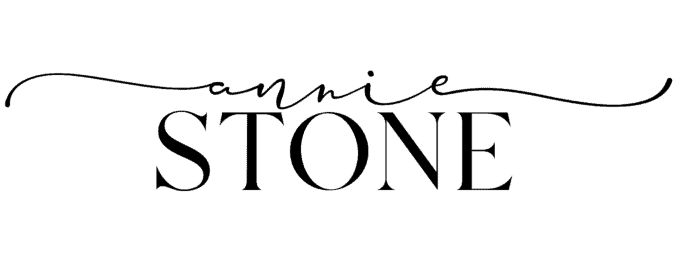
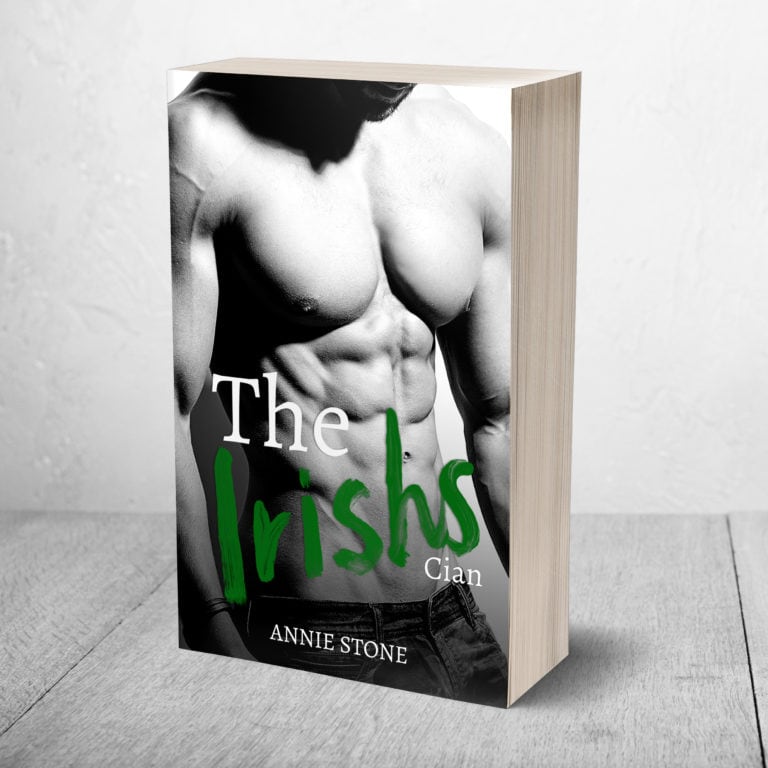
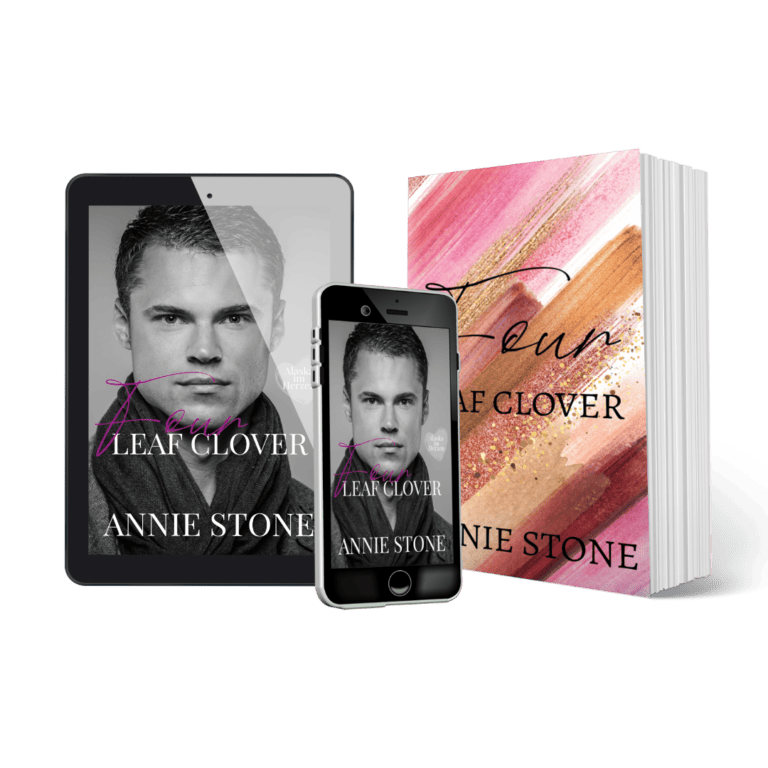


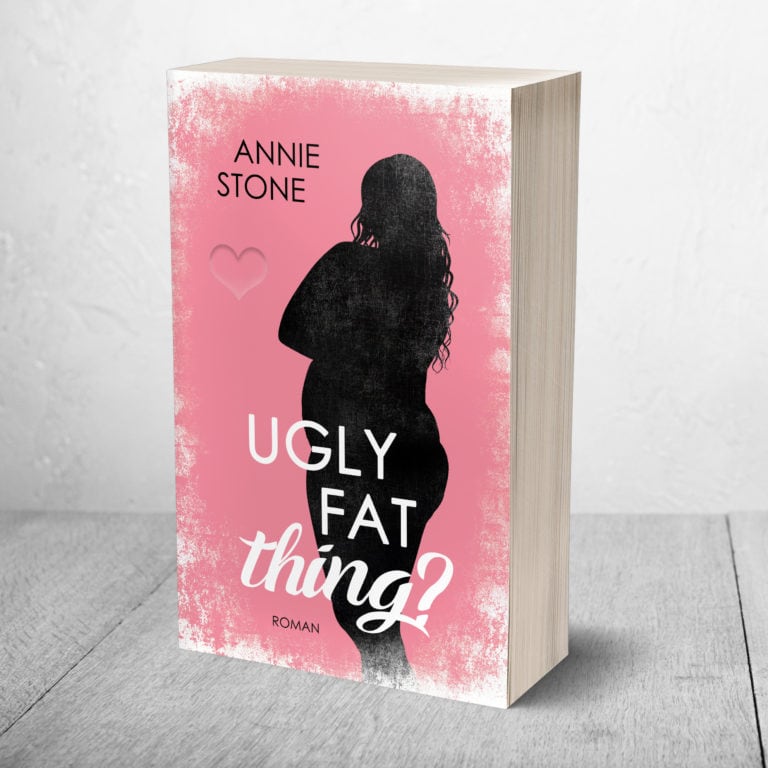
Hallo Liebe Annie. Hiermit möchte ich mich deiner Bloggergruppe anschliessen. Dein neues Buch spricht mich mega an. Fiebere schon dem Release zu.
Lg Kim
Liebe Kim, trag dich bitte hier ein: https://www.subscribepage.com/anniesblogger <3 Danke dir!